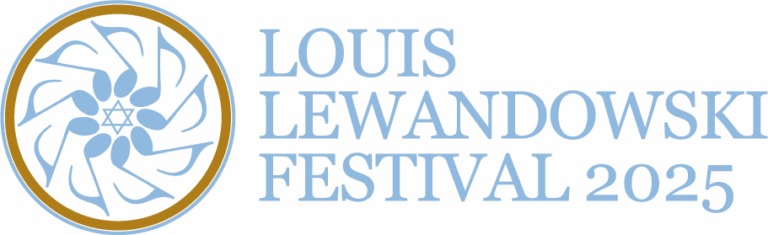Hierzu gehörten: Deutschland, Österreich, Frankreich, Niederlande, USA, Russland, Ukraine, Italien und Israel.
Es war eine Reise durch die Geschichte der Synagogalmusik aschkenasischer wie italienischer Gemeinden, die uns in schriftlicher Form als Notenquellen zur Verfügung standen.
Hinzu kam die Musik sephardischer Juden aus der Türkei, Griechenland, Bulgarien, Ägypten, Tunesien und Marokko sowie die Musik orientalischer Gemeinden aus dem Nahen Osten mit Ursprung im Iran, Irak, Buchara, Syrien und Jemen, deren Musik und Texte hunderte von Jahren alt sind und seitdem mündlich überliefert wird.
Rechnen wir diese dazu, haben wir jüdisch-religiöse Musik und Traditionen aus etwa 20 Ländern gehört.
Aschkenasische (westeuropäische+amerikanische) Synagogalmusik
Beginnen wir mit Louis Lewandowski (1821-1894), dem Namensgeber unseres Festivals, der im 19. Jahrhundert mit seinen beiden Werken der Synagogalmusik „Kol Rinnah u´T´flillah“ und „Toda we Simrah“ erstmals traditionelle Gebetsmelodien mit modernen Arrangements ganz im Stile des 19. Jahrhunderts versah und für Kantor, Chor und Orgelbegleitung das ganze liturgische Jahr auskomponierte. Hiervon hören Sie zu Beginn des Eröffnungs- und Abschlusskonzertes 3 Kompositionen. „Enosch“, „L´Dovid Boruch“ und „Zaddik kattomor“.
Seine Musik prägte nicht nur den Gebetsstil in liberalen wie orthodoxen Synagogen Berlins und des deutschsprachigen Raumes, sondern übte ihren Einfluss bereits im 19. Jahrhundert auf viele andere kulturelle Zentren in Europa wie auch im 20. Jahrhundert in Israel und den USA aus.
Im 19. Jahrhundert war die Entstehung einer neuen Synagogalmusik eng verbunden mit der Emanzipation und der gesellschaftlichen Gleichberechtigung der Juden.
Ein ähnliches Phänomen gab es bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts in der kleinen italienischen Stadt Mantua, in der Juden zwar in ihrem Stadtteil (Ghetto) wohnen mussten, sich jedoch am Tage frei in der nichtjüdischen Gesellschaft bewegen und arbeiten konnten.
Salamone Rossi (1670-1728), der als Musiker und Komponist am Hofe von Mantua in der Barockzeit wirkte, schrieb im Laufe von vier Jahrzehnten zahlreiche Instrumental- und Vokalwerke mit weltlichen Texten.
Und er war der erste jüdische Komponist, der eine Sammlung von 33 Motetten mit hebräischen Gebetstexten herausgab. Hierzu gehören das „Adon Olam“ als Beispiel der in Italien entwickelten Mehrchörigkeit. Abraham Caceres (1718-1740), den man zum Spätbarock zählt, stammte aus einer sephardischen Familie in Amsterdam. Dieses wunderschöne Stück schrieb er zur Einweihung der Portugiesischen Synagoge, die heute noch besucht werden kann.
War Berlin mit Louis Lewandowski das Zentrum der Synagogalmusik und Vorbild für Komponisten, die den Geist der Erneuerung in ihren Kompositionen verwirklichen wollten, so ist im gleichen Atemzug Salomon Sulzer (1804-1890) „Deutscher Segen“ in Wien und später Max Löwenstamm (1814-1881) „Howu Ladonoj“ in München zu nennen. Salomon Sulzer war der erste Chasan (Kantor) im modernen Europa, der durch seine außerordentlichen musikalischen, intellektuellen sowie sein Charisma bestach. Viele Kantoren aus ganz Europa reisten zu ihm, um bei ihm zu lernen.
Seine Reformen waren Inspiration für Samuel Naumbourg (1817-1880) in Paris wie auch für Komponisten der sogenannten Chorschultradition in Osteuropa, u.a. mit Zentrum in Odessa. Werke aller vorgenannten Komponisten werden zu hören sein.
Naumbourg, ausgestattet mit einer soliden Ausbildung der traditionellen Gesänge aus Süddeutschland und Wien, verband diese mit den Einflüssen der französischen Kunstmusik und Oper zu einzigartigen Kompositionen, zu hören in dem Stück „Etz Chayim“ beim Einheben der Tora.
Auch in der osteuropäischen Chorschulmusik findet sich eine Weiterentwicklung des Musikstils aus Wien und Berlin. Wir erleben höchst emotionale und romantische Musik für Kantor, Chor und Orgel, die sich einerseits an der traditionellen Gottesdienstmusik orientiert, sie andererseits mit „russischer Seele“ durchdringt und weiterentwickelt.
Beispiel hierfür ist das „Adonoi Z´choronu“ von David Nowakowski (1848-1921) zu hören.
Zuletzt wenden wir uns 3 zeitgenössischen Komponisten aus den USA zu. Das Adon Olam von Charles Davidson (*1929), in dem er den Text mit jazzigen Motiven untersetzt, das überall beliebte Samachti BeOmrim Li von Charles Osborne (*1950) und der wohl populärsten Vertonungen von Meir Finkelstein (*1951) L´Dor va Dor, die weit über die Grenzen der Synagogen verbreitet sind.
Die Musik Israel
Das einleitende Stück Ya-ala, Ya-ala wurde von einem aus Marokko eingewanderten Komponisten Avraham Eilam-Amzallag (*1941) geschrieben. Dieses versetzt die Zuhörer in eine ganz andere nordafrikanische Klangwelt.
Aus dem 20. Jahrhundert können wir uns an den Kompositionen
„Dror Yikra“ von Yehezkel Braun (1922-2014) und „Shir Hanoded“ von Paul Ben-Haim (1897-1984) (beide Komponisten aus der Weimarer Republik ausgewandert) erfreuen, die sich beide besonders mit den Einflüssen Volksmusiken beschäftigten und diese in ihre Kompositionen integrierten und damit einen wesentlichen Anteil an der Schaffung einer neuen modernen israelischen Musik hatten.
Das Konzert wird beendet mit zwei Liedern von einer der größten
israelischen Sängerinnen und Songwriter, Naomi Shemer (1930-2004) und den für sie von Gil Aldema (1928-2014) meisterhaft geschriebenen Arrangements. Sheleg Al Iri eine der schönsten Vertonungen und Yerushalayim Shel Zahav, das Lied, das zur zweiten (inoffiziellen) Nationalhymne Israels wurde.
Ich wünsche allen Konzertbesuchern, die Vielfalt synagogaler Musik zu genießen.
Regina Yantian